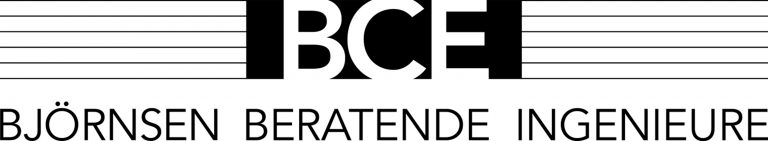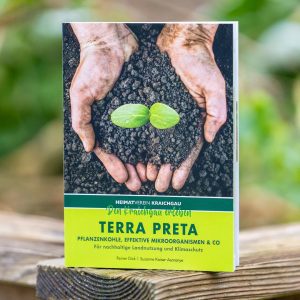
Buchneuerscheinung zu „Terra Preta“ mit Beitrag über die Darmstädter Karbonisierungsanlage
Vor rund 500 Jahren sorgte eine schwarze Erde im Amazonas für reiche Ernten. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde sie wiederentdeckt und ausgiebig erforscht. Als wichtigster Bestandteil stellte sich die Pflanzenkohle